Wenn ich es recht sehe, dann gehören die meisten in der „emergent“-Blogosphäre entweder in selbständige christliche Gemeinschaften, Freikirchen oder landeskirchliche Gemeinden besonderen Typs. Ein bisschen exotisch komme ich mir da schon vor als Pastor einer ländlichen landeskirchlichen Ortsgemeinde. Deswegen schreibe ich heute etwas darüber, was ich als unterschiedliche Perspektive von Landes- und Freikirchen wahrnehme.
- Zunächst einmal: der Unterschied liegt eigentlich nicht in der Theologie. In all den Diskussionen über das Ende der „Christendom“-Ära wird deutlich, dass aus dieser Perspektive gar kein großer Unterschied zwischen Landes- und Freikirchen ist. Oder, anders gesagt: die Freikirchen haben sich organisatorisch von der Staatskirche getrennt, sind ihr aber theologisch an den entscheidenden Punkten treu geblieben. Aus der Post-Christendom-Sicht rücken Gegensätze wie Kinder/Glaubenstaufe, Mitgliedschafts- oder Entscheidungschristentum, ja sogar die Frage nach den Charismen in die zweite bis dritte Reihe. Und ich habe erlebt, dass freikirchliche church plants dem Pfarramt die starke Stellung einräumen, die es sonst nur in der Landeskirche hat – und das als Schritt nach vorn beschreiben (wegen der Innovationschancen). Und die These, dass die Ära des „Christendom“ zu Ende geht, kommt ja u.a. aus den USA, die nie unsere landeskirchlichen Strukturen hatten.
- Es gibt hier eine sehr grundlegende gemeinsame Basis, die die allermeisten Christen in unserem Land, aber auch in vielen anderen Ländern verbindet, eine gemeinsame Systemgeschichte. Die ist das Problem, und wie wir die neu erzählen können, wissen wir alle noch nicht so genau.
- Aber im Bereich freier Gemeinden und Gemeinschaften gibt es offensichtlich mehr Nischen, in denen über neue Dinge nachgedacht werden kann. Man hat da nicht so viele Vorschriften, die man beachten muss. Und man hat mehr Leute, die sich auch ganz persönlich mehr von Jesus erwarten.
Obwohl, da würde ich gern mal was von den Brüdern und Schwestern aus den entsprechenden Gruppierungen hören: wie groß ist eigentlich bei euch der Druck zur Konformität? Kann die stärkere persönliche Verbundenheit eigentlich auch eine Blockade sein, die einen bei neuen Gedanken ausbremst? Das ist keine Behauptung, sondern eine echte Frage. Ich hab da zu wenig Übersicht. Aber wenn dann einer auf neue Gedanken kommt, dann findet er in freien Gemeinden auch schneller eine interessierte Umgebung – stimmt das? - Ich selbst schätze an meiner Arbeit in einer landeskirchlichen Gemeinde, dass man als Pastor immer wieder mit einem repräsentativen Querschnitt durch die Gesellschaft zu tun bekommt. Ich habe Konfirmanden von Sonderschule bis Gymnasium (und die Eltern dazu), ich beerdige Leute aus jeder sozialen Schicht, höre ihre Lebensgeschichten und denke mich in ihre Lebenswelt hinein. Ich kann mich in keine fromme Sonderwelt zurückziehen. Die Kultur der normalen Leute holt mich immer wieder ein. Nicht, dass ich es dann immer richtig mache, aber ich werde die Aufgabe nicht los.
- Was ich theologisch überlege, muss ich auch Viertklässlern erklären können; oder ich muss herausfinden, was das für Hochzeiten und Traueransprachen bedeutet. Wenn ich kulturell irrelevant werde, bekomme ich schnell und manchmal auch heftig Reaktionen. Andererseits: wenn Konfirmanden bei irgendetwas tatsächlich zuhören und verstehen, kann es nicht ganz falsch sein.
- Dieser Vorteil gleicht für mich die natürlich auch vorhandenen Schattenseiten der Landeskirche entscheidend aus. Als solche würde ich sehen:
– das chronische Misstrauen gegenüber den Gemeinden und Pastoren, kurz: gegenüber der Basis;
– die Kontrolle, die damit verbunden ist und unheimlich viel Reibungsverluste bedeutet, die Energie und Zeit rauben;
– das Denken in Strukturen, Ordnungen, Vorschriften, Institutionen. Dass es dabei eigentlich doch um die Menschen gehen sollte, verschwindet faktisch dahinter (auch wenn es natürlich immer wieder verkündet wird);
– die organisatorische Schwerfälligkeit und die denkerische Horizontbegrenzung, die solch feste Strukturen fast immer mit sich bringen;
– die zentrale Finanzierung bedeutet, dass die Ortsgemeinden die Finanzen bekommen, die übrig bleiben, nachdem alle anderen kirchlichen Ebenen versorgt sind. Hätten wir das Geld, das unsere Mitglieder als Kirchensteuer bezahlen, dann hätten wir keine finanziellen Probleme und könnten trotzdem noch eine ganze Menge für übergemeindliche Zwecke abgeben!
So weit erst einmal meine Eindrücke. Ich würde mich freuen, wenn du aus deiner speziellen Sicht etwas dazu schreiben würdest!
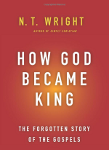
Sehr interessant für mich als jemandem, der sich in den letzten 10-12 Jahren ständig zwischen den beiden Welten der Landes- und Freikirchen bewegt hat (in Heidelberg war dies zuletzt die FeG). Ich weiß heute, dass ich meinen Platz in der (hannoverschen) Landeskirche sehe, aber nicht nur, weil „die da auch fromme Leute brauchen“, sondern weil ich mich dort auch am wohlsten fühle – trotz aller Schwierigkeiten, die ich auch gut kenne.
Mein Eindruck ist allerdings auch, dass die durchschnittliche freikirchliche Gemeinde (die statistisch auch deutlich weniger als 100 Mitglieder hat und zu einem großen Teil aus Senioren besteht) egal welcher Coleur ungefähr genauso unbeweglich ist wie ihr landeskirchliches Pondon. Wahrscheinlich sind uns aber gerade im freikirchlichen Bereich besonders die besonders „erfolgreichen“ Gemeinden bekannt.
Was du zur Pastorenzentrierung und Konformität im Denken schreibst, kann ich sehr gut nachvollziehen – gerade in freikirchlichen Gemeinden, in denen wenig institutionell geregelt ist, ist die Machtverteilung meiner Erfahrung nach oft (längst nicht immer) auf besonders wenige konzentriert. Was die Weite im Denken betrifft, stösst man glaube ich sowohl in Landes-, als auch in Freikirchen immer wieder auf Grenzen.
Ich persönlich kämpfe gerade so ein bißchen mit dem, was ich hier in den Staaten erlebe: Jeder, der gerade Lust hat und meint, dass er das Ganze finanzieren kann, macht eine eigene Gemeinde auf – meist ohne groß (zumindest über die eigene Denomination hinaus) zu gucken, welche Gemeinden es schon in der Gegend gibt. Kann man einfach sagen: Je mehr unterschiedliche Gemeinde, desto besser? Oder sind wir als Christen zuerst daran gehalten, uns den christlichen Gemeinschaften vor Ort anzuschließen und eher im Ausnahmefall (aus guten Gründen) eine neue Gemeinde zu gründen – letzteres wäre hier in den USA ein völlig unvorstellbarer Gedanke …
Ich finde das Schöne an den „emerging“ – Gedanken, dass sie viele von diesen Fragen relativieren: muss Gemeinschaft Jesu nicht noch eine ganz andere Gestalt annehmen, als wir bisher als (landeskirchliche oder freikichliche) „Gemeinde“ kennen? Etwas, bei dem die Finanzen gar nicht mehr so wichtig sind?
Aber spannend bleibt natürlich die Frage, wie das sich dann untereinander koordiniert.
Einblicke eines kurhessischen Landeskirchlers:
Auch wenn wir als Kirchengemeinde weit entfernt sind uns als -emergent- zu bezeichnen, so sind manche Einsichten und Ideen gerade auf eine Kirchengemeinde gut übertragbar. Wer hat denn die Symbole (z.B. das große Kreuz über dem Altar), wenn nicht wir? (naja, die Katholiken haben noch ein paar mehr…)
Reibungspunkte mit der Kirchenhierarchie sehe ich weniger. Wenn man bestimmt auftritt und seine Meinung klar kundtut, dann kommen bspw. auch Präses und Bischof bei der Pfarrerbesetzung trotz „Bischofswahl“ nicht an den Vorstellungen des Kirchenvorstandes herum.
Als Synodaler kämpft man dann schon eher mit der Unbeweglichkeit und darf viel Geduld und Langmut mitbringen.
Das Finanzsystem ist allerdings wirklich weit davon entfernt die Ortsgemeinde zur Entfaltung zu bringen – lieber versorgt man jedes noch so exotische oder idiotische Projekt / Aufgabengebiet weiter mit Geld. Obwohl eine knappe Kirchenkasse kann auch Kreativität freisetzen – und letztlich unabhängiger machen (ca. 1/4 unseres Haushalts besteht aus Spenden&Kollekten für uns und andere).
Ich als Nichttheologe schätze jedenfalls die Freiheiten einer ev.Kirchengemeinde.
Hallo, ich werde ab Freitag mit Pfarrern der Thüringer Landeskirche zusammen sein, die sich mit der Frage beschäftigen, wie sieht die Kirche nach der Kirche aus. – Es gibt sie also, die Landeskirchler, die an spannenden Fragen arbeiten und nach Wegen suchen. Im Mai 2006 gab es in Romanshorn einen ersten Kongress für Gemeindeinnovation. Jetzt hoffe ich, dass es einen zweiten Kongress im kommenden Jahr gibt, bei dem es eine nächste Möglichkeit zur persönlichen Vernetzung der Innovatoren aus Landes- und Freikirchen gibt. Der erste Kongress war bereits ein sehr guter Auftakt dafür.
Nachdem ich einiges in Deinem Blog gelesen habe glaube ich, wir sollten einmal telefonieren. Ich werde nach dem Treffen in Thüringen einen Anlauf unternehmen.
Zum 3. Pkt.
Also ich kann keinen erheblichen Unterschied zw.
Freikirche u. Staatskirche entdecken. Erst recht
nicht, wenn es darum geht etwas Neues auszuprobieren.
Sicherlich, es müssen in einer Freikirche nicht so viele
Bürokratische Hürden genommen werden, aber letzten Endes
geht es immer um das gleiche: die Machtfrage.
Dies habe ich überall erlebt, in Frei- u.
Staatskirchen. Ich denke, es kommt auf die Gemeinde und
ihre Zielvorstellung (weiß nicht wie ich das sonst
beschreiben soll) an, egal welchen Nachnamen sie hat,
was möglich sein kann.
lg,markus